Wie lassen sich die „Gefäße des Zorns“ (Römer 9,22) mit der Allversöhnung vereinbaren? Römer 9–11 gehört zu den herausforderndsten und zugleich tiefsten Abschnitten des Neuen Testaments. In diesem Artikel zeige ich, warum diese Kapitel nicht die Vorstellung einer ewigen Hölle stützen, sondern vielmehr darauf hindeuten, dass Gott alle Menschen erretten wird.
Das Problem
Manche, die die Allversöhnung ablehnen, berufen sich auf Römer 9. Dort zeichnet Paulus das Bild eines göttlichen Töpfers, der „Gefäße des Zorns“ und „Gefäße des Erbarmens“ formen kann. Auf den ersten Blick klingt das nach einer gnadenlosen Vorherbestimmung: Gott schafft manche Menschen zum Heil und andere zum Verderben – Punkt. Wenn das stimmt, scheint die Vorstellung einer endgültigen Versöhnung der gesamten Schöpfung mit Gott unbiblisch.
Besonders die Verse Römer 9,18–23 werden als Grundlage einer Lehre der doppelten Prädestination verstanden: Gott erwählt die einen zur Rettung und die anderen zur ewigen Verdammnis. In dieser Lesart bleiben die „Gefäße des Zorns“ ewig verloren.
Ich möchte in diesem Artikel zeigen, dass diese Deutung nur entsteht, wenn man eine grundlegende hermeneutische Regel missachtet: Ein Text darf nicht isoliert, sondern muss in seinem Kontext gelesen werden. Diese wichtige Regel zu ignorieren führt zu toxischer Theologie.
Der Aufbau des Römerbriefs
Der Römerbrief lässt sich in zwei Hauptteile gliedern: Kapitel 1–11 und 12–16. In den ersten elf Kapiteln entfaltet Paulus sein Verständnis vom Evangelium – also davon, wie Gott die Welt rettet und erneuert. Dabei entwickelt er seine Gedanken in drei großen Abschnitten: Röm 1–4, 5–8 und 9–11. In den Kapiteln 12–16 zeigt er dann, was das alles ganz praktisch für unser Leben bedeutet.
Römer 11 bildet also den Abschluss des theologischen Hauptteils. Hier fasst Paulus seine Argumentation zusammen und bringt alles auf den Punkt. Das ist wichtig zu beachten: Wenn unsere Auslegung seiner Gedanken nicht zu seinem eigenen Fazit in Römer 11 passt, haben wir ihn vermutlich missverstanden. Bevor wir uns aber diesem großen Finale widmen, lohnt sich ein genauerer Blick auf Römer 9 – das Kapitel, das für viele schwer zu verstehen ist.
Römer 9
Römer 9 muss im Kontext von dem großartigen Finale von Kapitel 8 gelesen werden. Paulus beendet Römer 8 mit der atemberaubenden Aussage, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann.
Für wen gilt diese Zusage? Durch den ganzen Brief hindurch gebraucht Paulus eine Sprache, die das Ganze der Schöpfung im Blick hat. In Kapitel 5 schreibt er: So wie alle Menschen durch Adam in die Sünde geraten sind, so werden auch alle durch Christus gerettet. In Kapitel 8 beschreibt er, dass die gesamte Schöpfung seufzt und auf Erlösung wartet. Und wenn er in Römer 8,32 betont, dass Gott seinen Sohn „für uns alle“ dahingegeben hat, dann steht auch die Zusage, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, nicht nur den Christen zu – sie gilt letztlich allen Menschen.
Wenn man dies im Blick behält, ist es kaum vorstellbar, dass Paulus gleich im nächsten Kapitel plötzlich das Gegenteil behaupten will – dass Gott einen Teil der Menschheit dazu bestimmt hätte, ewig von seiner Liebe getrennt zu bleiben. Genau das hat er ja gerade ausgeschlossen.
Im ersten Teil seines dritten theologischen Gedankengangs (Röm 9–11) betont Paulus, dass alles davon abhängt, über wen sich Gott erbarmt (Röm 9,14–15). Das müssen wir im Kopf behalten, weil Paulus diesen Gedanken wieder aufgreifen und diesen dritten Abschnitt mit genau diesem Gedanken auch abschließen wird.
Ab Römer 9,16 entfaltet Paulus eine dichte Argumentation, die sich bis Kapitel 11 hinzieht – ein Abschnitt, der zu den schwierigsten der ganzen Bibel gehört. Nicht jedes Detail lässt sich leicht entschlüsseln, doch wer genauer hinschaut, erkennt: Paulus spricht hier nicht über einen willkürlichen Gott, der Menschen zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt, sondern über einen Gott, der voller Barmherzigkeit ist.
Das Hauptthema des Römerbriefs ist die Gerechtigkeit Gottes. Schon im ersten Kapitel sagt Paulus, dass das Evangelium diese Gerechtigkeit offenbart (Röm 1,17). In Römer 9–11 greift er nun den Einwand auf, Gott sei vielleicht ungerecht (Röm 9,14) – und seine ganze Argumentation zielt darauf, genau diese Lüge zu widerlegen. Ein Gott, der willkürlich einige Menschen zur ewigen Verdammnis bestimmt, wäre kein Beweis für göttliche Gerechtigkeit, sondern würde den Vorwurf der Ungerechtigkeit nur bestätigen.
Es ist wichtig festzuhalten, dass Paulus nirgends sagt, dass Gott Menschen zu Gefäßen des Zorns geschaffen hat. In Römer 9,21 stellt er lediglich die theoretische Frage, ob Gott als Schöpfer das Recht dazu hätte – aber er behauptet nicht, dass er es auch tut. Im Gegenteil, der nächste Vers macht deutlich, dass Gott Geduld mit diesen „Gefäßen des Zorns“ hat.
Römer 9,22 (Basisbibel):
Dabei gilt: Gott will zwar seinen Zorn zeigen und seine Macht offenbaren. Aber dennoch hat er die Gefäße, die seinen Zorn erregen, mit großer Geduld ertragen – also Gefäße, die eigentlich zum Zerschlagen erschaffen wurden.
Wie also geht Gott mit den „Gefäßen des Zorns“ um? Mit großer Geduld! Um Paulus richtig zu verstehen, müssen wir in seinem Denken bleiben. In Römer 1 definiert er den „Zorn Gottes“ sehr klar: Gottes Zorn zeigt sich darin, dass er die Menschen ihren eigenen Weg gehen lässt. Er überlässt sie den Folgen ihrer Entscheidungen – und diese führen ins Leid, weil Sünde immer zerstört.
Das heißt: Gott macht Menschen nicht zu „Gefäßen des Zorns“. Sie werden es selbst, indem sie sich bewusst von ihm abwenden. Und weil sie diesen Weg gewählt haben, sind sie verdorben/es wert, zerschlagen zu werden.
Doch selbst diesen Menschen begegnet Gott nicht mit Hass, sondern mit Geduld. Um das zu betonen, zitiert Paulus in Römer 9,25 den Propheten Hosea, wo Gott sagt, dass er „die Nicht-Mein-Volk“ zu seinem Volk macht. Mitten in der Rede über Zorn und Gericht bricht also wieder das Thema Liebe durch.
Ein weiteres wiederkehrendes Grundmotiv des Römerbriefs hilft, diesen Gedanken zu verstehen: Gott bringt aus unserem Versagen Gutes hervor. Das zieht sich durch den ganzen Brief – von der Zusage, dass Gott „alles zum Guten wirken lässt“ (Röm 8,28), bis zur Aussage, dass Israels Verfehlung zur Rettung der Völker geführt hat (Röm 11,15).
Versagen und Rebellion sind nicht das Ende bei Gott. Gott macht Dünger aus unserem Mist. Paulus führt mit seiner Argumentation auf ein viel größeres Ziel hin – eines, das im großen Finale von Römer 11 deutlich sichtbar wird.
Römer 11: Das Fazit des Paulus
Paulus beendet sein theologisches Meisterwerk – die Kapitel 1 bis 11 des Römerbriefs – mit einem Fazit, das kaum deutlicher sein könnte. Er greift den Gedanken vom Beginn dieses Abschnitts wieder auf: Alles hängt davon ab, über wen Gott sich erbarmt (Röm 9,14–15). Genau diesen Faden führt er nun zu Ende und bringt seine gesamte Argumentation zu einem monumentalen Höhepunkt. Das große Schlusswort seiner Theologie finden wir in Römer 11,32 (Schlachter):
Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme.
Für Paulus besteht das Evangelium, das Gottes Gerechtigkeit offenbart, in dieser gewaltigen Wahrheit: Am Ende wird Gott sich über alle Menschen erbarmen. Gott will, dass alle gerettet werden – und er wird dieses Ziel auch erreichen. Selbst wenn Menschen sich gegen ihn stellen, ist seine Liebe stärker als ihre Rebellion. Gott wird alle zur Umkehr führen und für Gerechtigkeit für alle Menschen sorgen – nicht durch Zwang, sondern durch die Macht seiner Liebe, die den freien Willen des Menschen achtet und geduldig und sanftmütig Menschen verwandelt.
Dieses allumfassende Fazit überrascht nicht. Paulus hat dieses Fazit bereits immer wieder durchscheinen lassen:
– In Römer 3,22–24 erklärt er, dass alle gesündigt haben – und alle durch Gnade gerecht gemacht werden.
– In Römer 5,12–21 entfaltet er, dass wie durch Adam alle in die Sünde geraten sind, so durch Christus alle zum Leben geführt werden.
– In Römer 8,18–23 beschreibt er die seufzende Schöpfung, die in Schmerzen (Geburtswehen) auf ihre Erlösung wartet – eine Hoffnung, die sich auf die ganze Schöpfung erstreckt, weil nichts Gottes Schöpfung von seiner Liebe trennen kann.
– In Römer 11,15 sagt er bereits, dass das Versagen Israels zur Rettung der gesamten Welt führt.
– Und schließlich kulminiert alles in Römer 11,36: „Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.“
Der Römerbrief ist also kein Lehrbuch über Verdammnis, sondern ein Hymnus auf die unaufhaltsame Gnade Gottes, die alles Geschaffene heimführt in das Herz der Liebe, aus der es einst hervorgegangen ist.
Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. (NGÜ)
Darum wird Gott nicht eher ruhen, bis seine ganze Schöpfung versöhnt und erneuert ist. Der Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, wird sein Werk auch vollenden. Seine Liebe treibt ihn an, bis er alles wieder versöhnt und wiederhergestellt hat.
Mein Fazit
Römer 1–11 ist kein Brief über individuelle Errettung, sondern die gute Botschaft von Gottes universaler Rettungsgeschichte. Paulus zeichnet hier kein enges System, sondern ein gewaltiges Panorama: Die Menschheit stürzt gemeinsam in den Abgrund der Sünde – und wird gemeinsam von der überströmenden Gnade Gottes ergriffen. Was im Dunkel der Schuld beginnt, endet in einem symphonischen Crescendo der Barmherzigkeit. Der Gott des Römerbriefs ist kein Richter, der ewig verdammt, sondern ein Schöpfer, der heilt und wiederherstellt. Er ist der geduldige Vater, der mit offenen Armen wartet, bis selbst der letzte verlorene Sohn wieder heimkehrt. Römer 1–11 ist ein Loblied auf den Gott, der den Tod ewig bezwungen hat – und der am Ende alles umfasst in seinem erbarmenden Ja. Paulus’ Evangelium ist die Geschichte eines Gottes, der nichts und niemanden dem Tod überlässt.
Der Römerbrief bestätigt damit das Zeugnis, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht: Gott will alle Menschen retten, er kann es – und genau deshalb wird er es auch tun. Weitere Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass Gott alle Menschen erretten wird, finden Sie hier:
Und hier erkläre ich, wie viele der bekannten „Höllenverse“ mit der Allversöhnung vereinbart werden können.
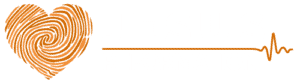
Schreibe einen Kommentar